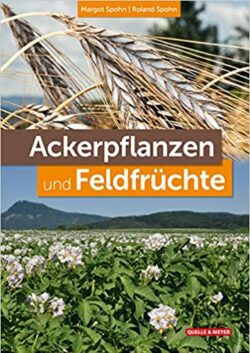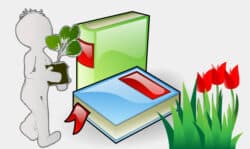Emmer/Zweikorn – Erkennen und Nutzen
Steckbrief, Bilder & Beschreibung der Ackerpflanze/Feldfrucht sowie ihr Nutzen für Ernährung und Gesundheit
Emmer, auch Zweikorn genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung Weizen (Triticum). Er ist, zusammen mit Einkorn, eine der ältesten kultivierten Getreidearten. Diese Weizenart mit lang begrannten, meist zweiblütigen Ährchen wird heute in Europa kaum noch angebaut – wenn, dann im Wesentlichen der Schwarze Emmer, daneben gibt es den Weißen Emmer und Roten Emmer. Seine Stammform ist der Wilde Emmer (Triticum dicoccoides).
Informationskategorien zu dieser Ackerpflanze/Feldfrucht
Ackerpflanze-Steckbrief „Emmer/Zweikorn“
Botanischer Name: Triticum dicoccum
Deutscher Name: Emmer
Ordnung: Süßgrasartige (Poales)
Familie: Süßgräser (Poaceae)
Gattung: Weizen (Triticum)
Art: Emmer
Weitere Synonyme/Volksnamen: Zweikorn
Erkennungsmerkmale/Bestimmungshilfe
Wird als Sommer- und Wintergetreide einjährig angebaut. Beim Emmer sind die (zwei) Körner fest mit einer umhüllenden Spelze zu einer sogenannten Vese verwachsen. Damit das Körner verarbeitet werden können, müssen die Spelzen nach der Ernte mit dem Mähdrescher in einem gesonderten Arbeitsschritt („Rellen“ oder „Gerbgang“) entfernt werden. Gesät werden die Vesen (also das Korn mit dem Spelz).
Wuchshöhe: Emmer wird ca.140 cm (Sommeremmer) bis 180 cm (Winteremmer) hoch.
Halm: besitzt einen aufrechten, ziemlich kräftigen, steifen und festen Halm.
Blattöhrchen: groß und bewimpert;
Blatthäutchen: mittelgroß und gezahnt;
Deckspelzen: begrannt, zwei Grannen je Ährchen, (Grannenlänge beträgt einige Zentimeter);
Kornanlage: deutlich zweizeilig angeordnet;
Körner pro Ährchen: Zwei Körner pro Ährchen,
Körner: fest von Spelzen umschlossen;
Bestäubung: erfolgt durch Selbst- oder Fremdbestäubung
Verwendungszweck: Emmer wird zu Mehl, Brot, Gebäck oder Nudeln verarbeitet. Die Verarbeitung verlangt jedoch einiges an Geschick, da zwar sehr hoher Klebergehalt, jedoch geringe Kleberqualität gegeben ist. Die Verwendung von Backformen ist vorteilhaft. Neben Hafer gilt Emmer als besonders gutes Pferdefutter. Außerdem eignet sich Emmer zur Herstellung von Bier.
Mein Favorit ❤️ – Ackerpflanzen und Feldfrüchte. Mehr als 150 einjährige, mehrjährige, kultivierte und wildwachsende Ackerpflanzen und Feldfrüchte. Mit diesem Buch erschließt du dir die (Kultur-)Natur auf neue Weise!
(Amazon Partner-Link)
Bestimmung/Beschreibung der Ackerpflanze
Die Ähren des Emmers sind dicht und zusammengedrückt und erscheinen daher im Querschnitt rechteckig. Die Ähren des des Emmers sind meist länger als 5 cm, zur Blütezeit aufrecht, zur Reife jedoch leicht überhängend. Die Deckspelze ist bis zu 10 cm lang begrannt. Ihre Ährenachse, auch als Spindel bezeichnet, ist brüchig, was so viel heißt wie dass sie bei der Reife zerbricht. Die Früchte bleiben dabei jedoch fest von den Spelzen umschlossen.
Die einzelnen Ährchen des Emmers beinhalten drei, sehr selten vier Blüten, von denen zwei bis selten drei fertil sind, das heißt Körner ausbilden können (daher auch der Name Zweikorn). Die Hauptspelze ist fast geflügelt gekielt und an der Spitze mit einem scharfen Zahn versehen.
Die Stängel, auch als Halme bezeichnet, sind stielrund, aufrecht, steif und dickwandig oder gefüllt. Der Emmer hat kahle Stängelknoten, ist aber an der Ansatzstelle der Ährchen mit Haarbüscheln versehen
Die Laubblätter sind typisch für die Poaceae länglich linealisch, wechselständig und zwei-zeilig angeordnet mit einer langen stängelumfassenden Blattscheide.
Anbau der Ackerpflanze/Feldfrucht
Emmer hat keine besonders hohen Ansprüche an die Bodenart und den pH-Wert des Bodens.
Die Grundbodenbearbeitung sollte mit dem Pflug oder Grubber erfolgen. Die Saatbettbereitung sollte nicht zu fein sein, auf Grund der Strukturreserve und des Windhalms. Dies ist gleich wie bei der Saatbettbereitung von Weizen. Die Stoppelbearbeitung ist für die schnellere Rotte der Ernterückstände sehr sinnvoll.
Die Vorfruchtwirkung von Emmer ist mäßig, da die Übertragung von Krankheiten wie z. B. Halmbruch möglich ist. Die Selbstverträglichkeit ist nicht optimal; aus diesem Grund sollte zwei Jahre danach kein Wintergetreide angebaut werden. Eine gute Vorfruchtwirkung auf Emmer haben Kartoffeln und Mais.
Der Saatzeitpunkt liegt zwischen Mitte September und Mitte Oktober. Der Emmer ist sehr winterhart, da er Temperaturen bis ca. –20 °C aushält. Die Saatstärke sollte zwischen 150 und 200 kg/ha und die Saattiefe 4–6 cm betragen. Der Reihenabstand beträgt 10–25 cm. Da Emmer Spelzen hat, die rau und behaart sind, kann es zu Problemen bei der Aussaat kommen. Diese Probleme können umgangen werden, wenn man das Emmerkorn entspelzt.
Nutzung der Ackerpflanze/Feldfrucht
Emmergetreide ist eiweiß- und mineralstoffreich. Trotz seiner mäßigen Klebereigenschaften ist Emmer auch für die Brotherstellung geeignet. Vollkornbackwaren verleiht Emmer einen herzhaften und leicht nussigen Geschmack. Ebenso wird der Emmer für die Bierherstellung eingesetzt. Das Emmerbier ist dunkel, meist trüb und sehr würzig.
Die Ähren sind in der Floristik in vielen Gestecken vorhanden. Die gekochten Körner können als Einlage für Suppen und Eintöpfe, aber auch in Salaten, Aufläufen oder Bratlingen verwendet werden.
Forscher der Universität Hohenheim (Stuttgart) und Vertreter des baden-württembergischen Landesinnungsverbandes der Bäcker haben einen „Arbeitskreis Spelzgetreide“ (Einkorn, Emmer und Dinkel) gegründet, in dem auch Müller und Nudelfabrikanten vertreten sind, um den Anbau dieser frühen Weizensorten wieder zu fördern.
Als italienische Spezialität bekannt ist die so genannte Zweikornsuppe (zuppa al farro), ein deftiger Emmereintopf, der vor allem für die ländlichen Gebiete der Toskana typisch ist und als klassisches „Armeleutegericht“ gelten kann.
Geschichte & Entwicklung
Emmer gehört zu den ältesten kultivierten Getreidearten. Die Pflanze lässt sich bis 3000 v. Chr. zurückverfolgen. Ihren Ursprung hat sie im Nahen Osten, dort wird sie seit mindestens 10.000 Jahren angebaut. Durch die Ausbreitung des Ackerbaus kam der Emmer von Westpersien über Ägypten, Nordafrika und den Balkan bis nach Mitteleuropa.
Der Emmer galt zur Römerzeit als „Weizen von Rom“. Erst ab der Neuesten Zeit verlor er in Europa an Bedeutung; im Laufe des 20. Jahrhunderts stieg die Anbaufläche für Emmer jedoch wieder an.
Zusatzinformationen & Wissenswertes
Heute ist Emmer in Mitteleuropa nach wie vor ein Nischenprodukt, gewinnt aber regional an Bekanntheit. In Nordbayern wird im Raum Coburg wieder Emmer angebaut und dort unter anderem für die Bierherstellung verwendet (auf Emmerbier hat sich z. B. das Riedenburger Brauhaus spezialisiert). Der Emmeranbau wurde dort im Rahmen eines Projektes zur Förderung des Anbaus alter Kulturarten sowie seltener Ackerwildkräuter wieder aufgenommen.
In Österreich wird Emmer im Burgenland und in Niederösterreich angebaut und über Bio-Läden und Supermärkte vertrieben. In der Schweiz wird der Weiße Emmer im Schaffhauser Klettgau wie auch im Zürcher Weinland seit Mitte der 1990er Jahre wieder angebaut. Zu den daraus verarbeiteten Produkten zählen neben Emmerkörnern und -mehlen auch Spezialbrote, Teigwaren, Emmer-Schwarzbier und Emmerschnaps.
Schwarzer Emmer: Durch natürliche Selektion entstand aus dem Urgetreide Emmer der Schwarze Emmer (Triticum dicoccon var. atratum). Dieser wird als Winterung angebaut, da er einen höheren Ertrag hat als Emmer. UV-bedingte Mutationen sind beim Schwarzen Emmer kaum möglich, da er sich durch seine schwarze Färbung gut davor schützen kann. Aus diesem Grund ist er genetisch das beständigste Getreide. Die Schwarzfärbung wird durch Beta-Carotin verursacht.
Videobeitrag zu „Emmer/Zweikorn“ (ab Min. 25:47)
Quellen und weitere Informationen
- Ackerpflanzen und Feldfrüchte – von Margot Spohn
- www.landwirtschaft-bw.info – Kulturpflanzen im Ackerbau
- de.wikipedia.org – voll mit Baum & Strauch-Wissen
- www.lko.at – Wissensbeiträge der Landwirtschaftskammer
- www.biolib.de (Illustrationen von Bäumen & Sträuchern)
- viele weiter Webseiten & Bücher/Büchlein über Ackerpflanzen, Feld- & Zwischenfrüchte
Mehr Ackerpflanzen, Feld- und Zwischenfrüchte
Ackerpflanzen & Zwischenfrüchte Lexikon | Übersicht A-Z
Als Ackerpflanzen/Feldfrüchte werden die Kulturpflanzen, die auf Feldern angebaut werden, bezeichnet. Hier findest du ALLE im Lexikon beschriebenen Ackerpflanzen & Feldfrüchte auf einen Blick …